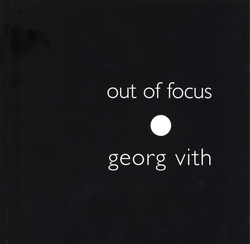|
Warten auf Bilder
Das Auge ist keine Kamera, sondern ein sehr langsam registrierendes Instrument, dessen Arbeit gesättigt ist mit Vorgängigem und Nachträglichem und die selbst eine eigentümliche zeitliche Struktur hat, sich in der Zeit abspielt (B. Busch). Die Begehbaren Kameras, die seit 1998 Bestandteil in Vith´s Wahrnehmungsarbeiten sind, erweisen sich als ein ebenso langsames Instrument. Deren Hilfe zur Bilderfindung benötigt schlicht und einfach Zeit. Ein vollständig abgedunkelter Raum, der nur punktuell Licht einlässt, kombiniert nach längerem Warten verschiedene Ebenen der Sichtbarkeit, macht aus zunächst fast unsichtbaren Positionen ein Netzwerk an sichtbaren Bruchstücken. Innen- und Außenwelt treten in Verbindung, werfen für den Betrachter Fragen auf und schaffen für ihn dadurch eine Ebene des Seins. Der Besucher einer derartigen Kamera ist angehalten, zumindest zehn bis fünfzehn Minuten zu warten, um das langsam auftauchende Bild wahrnehmen zu können und damit zu bemerken, wie sich ganz langsam ein Kopf stehendes Bild der Außenwelt auf das Interieur legt. Der Raum und ebenso das unbewaffnete Auge werden eingefangen durch ein allmählich entstehendes Bild, das ein direktes Verhältnis zum Umraum evoziert. Die Bild-Haut, die sich über den Innenraum gelegt hat, verändert sich allmählich und stetig, sie wandelt sich durch die Bewegung der Sonne und damit des Lichteinfalles. Blicke wandern entlang dieser Veränderungen, sie erfassen Geschichten über das Innen und Außen in Dialogform. Die Blicke wandern aber auch über das Innere des Betrachters, die Kamera verschafft dem Auge einen neuen Horizont der Vernunft (G. Anders). Die Räume bieten einen breiten Spielraum des Entdeckens und erzählen Geschichten in unterschiedlicher Form, determiniert durch Zeit, Ort und Situation, der Betrachter entwickelt sich zum Entdecker seiner eigenen Wahrnehmung. Die stete Unfertigkeit ist eine werkimmanente Gegebenheit, da eine extreme Fokussierung der Bilder nur annähernd möglich ist: je kleiner das Loch, durch das die Lichtstrahlen eindringen können, desto schärfer tritt das Bild dem Betrachter gegenüber. Gleichzeitig wird es auch lichtschwächer und entschwindet. Eine Vergrößerung der Öffnung ermöglicht besseren Lichteinfall, das Bild wird unschärfer. Das Prinzip der Kamera ist das Kennzeichen der Neuen Zeit, der im Quattrocento entdeckten Zentralperspektive, die einen gesellschaftlichen Paradigmenwechsel konstituierte. Die zunehmende Technisierung der Sinnesvermögen ab dem 15. Jahrhundert wird in einem aktuellen Buch von David Hockney beschrieben. Er spricht davon, dass in dieser Zeit viele Maler begannen, auf optische Hilfsmittel zurückzugreifen, und meint damit Spiegel, Linsen oder eine Kombination aus beiden, mit denen sie lebensnahe Bildprojektionen erzeugten, um direkt Gemälde oder Bilder anzufertigen. Dieses neue Verfahren, die Welt in Bildern festzuhalten, breitete sich schnell aus – und veränderte den Blick auf die Wirklichkeit (D. Hockney). Das Prinzip von Schärfe und Unschärfe ist auch in den Arbeiten zu finden, die der Künstler unter Verwendung seiner selbstgebauten Zeichenkameras entstehen lässt. Das Gehäuse der Camera obscura ist als Gerät zwischen die Wahrnehmung und deren Gegenstände geschaltet, gleichsam als Bote eines Wahrnehmungserlebnisses gesetzt. Dadurch wird die glatte Oberfläche des Alltäglichen brüchig, die Unschärfe unserer Wahrnehmung fällt auf uns zurück – unsicher rätseln wir, welcher so abstrakte Gegenstand uns in der Skizze entgegensteht, unserer schablonenhaften Sichtweise widersteht. Die Zeichnungen im Kreditkartenformat sind gleichsam Kartografien des Unscheinbaren und unterbrechen den Alltag, die allzu lange Pause unseres Denkens (R. Tiefenthaler). |